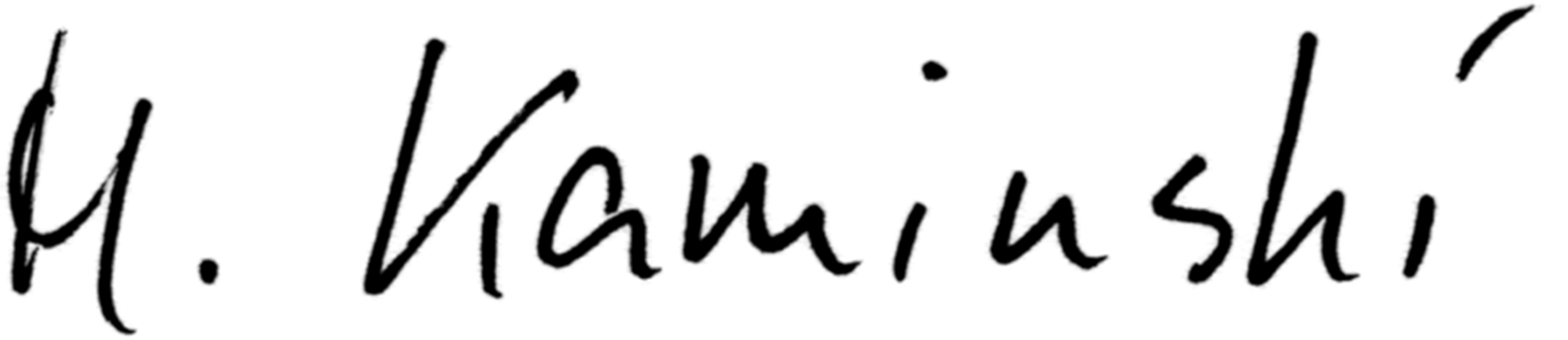Entstehungsgeschichte des Films
erzählt von Hartmut Kaminski
April 1988. Noch steht die Mauer in Berlin, noch zerteilt der „Eiserne Vorhang" die Welt in eine kapitalistische und eine sozialistische Zone.
Glasnost und Perestroika sind noch frische Begriffe, in der Praxis noch ungeübt.
Der Westberliner Journalist Paul Kohl und ich fliegen nach Moskau: er mit seinem Manuskript „Ich wundere mich, dass ich noch lebe" im Gepäck und ich mit zwei meiner Filme: ,,Stumme Schreie" und „Die Kinder von Himmlerstadt", die sich mit dem deutschen Faschismus im besetzten Polen auseinandersetzen.
So ausgerüstet, wollen wir den ,,Kampf am Verhandlungstisch" für eine Coproduktion mit dem Riesen APN (NOWOSTI) aufnehmen, der größten sowjetischen Presseagentur neben TASS. Der SWF hatte bereits signalisiert, dass er sich an einer sechsteiligen Fernsehserie über den Überfall auf die Sowjetunion beteiligen würde mit dem Titel: ,,Steh' auf, es ist Krieg!" - mit diesen Worten wurden am 22. Juni 1941 die Menschen in der Sowjetunion geweckt.
Birgt das „Steh' auf!" nicht eine Doppelbedeutung in sich? War dies nicht auch eine Aufforderung zum Widerstand?
Nach vier Verhandlungstagen mit ausführlichen Gesprächen und Sichtung meiner Filme gibt NOWOSTI-Chef Falin, der frühere Botschafter der UdSSR in Bonn, grünes Licht. Die Produktion der Fernsehserie kann starten.
In der Sowjetunion stößt unser Plan, einen Film über den ,,Großen Vaterländischen Krieg" (so wird der 2. Weltkrieg in der UdSSR genannt) zu drehen, auf größtes Interesse. Gleich nach unserem ersten Aufenthalt erscheint in der ISWESTIJA, der millionenauflagestarken Regierungszeitung, ein ganzseitiges Interview von Serge Guk mit uns, dazu ein großer Aufmacher auf der ersten Seite.
Zeigt dies, wie wichtig die offizielle Seite der UdSSR unser Projekt nimmt, so sind wir doch über die Reaktionen der Leser erstaunt: Aus allen Republiken der Sowjetunion - sogar aus dem Ausland - treffen Briefe ein. Viele davon sind handgeschrieben, manche sogar 20, 30 Seiten lang. Kein Schreiben steht dem Vorhaben negativ gegenüber. Mir werden viele Leidensgeschichten mitgeteilt, Hilfe angeboten und Mut und Stärke gewünscht.
In einigen Briefen redet man mich vertraulich mit dem Vornamen an, bittet darum, dies tun zu dürfen, als Zeichen der Hochachtung vor einem Westdeutschen, der nun, nach fast 50 Jahren, in ihr Land kommt, um den Menschen, die unter seinen Landsleuten so viel zu leiden hatten, zuzuhören.
Im Juni beginnen wir mit einem kleinen, vierköpfigen Team: eine sechswöchige „Researchreise mit Drehelementen" plus drei Wochen Archivarbeit. Hauptziel dieser Reise ist es, möglichst viele Berichte von Zeugen auf Zelluloid zu bannen.
Die Zeit drängt: Die Menschen, die das damalige Geschehen miterlebten, sind nun alt und gebrechlich, verlieren die Erinnerung. Viele, die Paul Kohl noch zweieinhalb Jahre zuvor gesprochen hatte, sind schon gestorben. Trotzdem zwinge ich mich, behutsam vorzugehen, erst das Vertrauen der Augenzeugen zu gewinnen. Zu tief ist der Graben zwischen Opfern und Tätern, als deren Erbe ich mich fühle.
Ich habe mir in den Kopf gesetzt, die Interviews nicht in der Geborgenheit ihrer Wohnung zu drehen, sondern will mit ihnen die Orte aufsuchen, wo das Unfaßbare geschah, möchte die Augenzeugen - und auch mich selbst - aus dem Schutzraum der Anonymität herausreißen. Leichter gedacht als getan. Immerhin liegen fast 50 Jahre da-zwischen: Viele Menschen sind inzwischen umgezogen, wohnen nun manchmal 200, 300 Kilometer entfernt. Die Orte von damals haben sich oft stark verändert: Wo früher ein Dorf stand, wächst jetzt dichter Wald.
Und kann ich diesen alten, gezeichneten Menschen eine solche Tortur zumuten? Sie haben das Erlebte mühsam über lange Jahre hinweg für sich verarbeitet. Nicht vergessen, aber eine Form gefunden, damit zu leben, indem sie es haben in sich versin-ken lassen. Nur in den schlaflosen Nächten und Alpträumen werden sie vom miterlebten Grauen heimgesucht.
So plagt mich das schlechte Gewissen, ich wage kaum zu fragen. Doch da ist der Film, der für die Zuschauer nur bedeutend werden kann, wenn sie spüren: dies ist keine einfach wieder erzählte Geschichte. Hier zeigt ein Mensch seinen Mitmenschen die noch immer nicht vernarbten Wunden.
Trotz mancher Ängste und anfänglicher Ablehnung schaffen wir es fast immer, diese beschwerliche und schwere Reise in die Vergangenheit anzutreten. Einige der Zeugen nehmen es auf sich, um den Gast, der sich diesem schweren Thema stellt und mehr als 2000 Kilometer fuhr, um mit ihnen zu sprechen, nicht vor den Kopf zu stoßen. Doch viele Zeugen verstehen dies auch als Herausforderung an sich selbst, spüren, dass dies vielleicht ihre letzte Konfrontation vor dem nahenden Lebensende mit dem Geschehen ist. Andere wollen sich von der Bürde erleichtern: Denn sie haben das ihnen angetane Leid über all die Jahre in sich bewahrt, um es späteren Generationen als Vermächtnis zu übergeben. Und nun ergreifen sie diese Chance, hoffen auf den Film.
Strahlen deshalb die sowjetischen Zeugen solche Würde und Feierlichkeit aus, wenn sie uns von damals berichten? Es ist für mich erschütternd, zu erleben, wie der Ort des Geschehens ihre Erinnerungen formt, Verschüttetes, Verdrängtes, Zugedecktes wieder hervorbringt. Eines dieser Erlebnisse:
Mit Frau Anna Lukjanowa besuchen wir einen weitentfernten Ort, abseits der Straße im tiefen 1 Wald gelegen. Sie braucht einige Zeit, sich zu orientieren, den richtigen Weg, die richtige Stelle zu finden. Hier hat sie das Massaker an ihren Kindern, anderen Verwandten und Mit-Dorfbewohnern überlebt. Zur Begrüßung der Toten legt sie sich auf das Grab, spricht dann in Wortfetzen halb zu den Toten, halb zu uns. Langsam setzt sich das Bild dieses Tages vor 46 Jahren zusammen. Beim Abschied küsst sie nochmals den Boden über den Toten, nimmt Abschied von ihnen, so al spüre sie ihren nahen Tod.
Plötzlich zerreißt ein Kettenbagger mit Ohren betäubendem Lärm die Stille, hebt das Erdreich dicht neben dem Grab aus: Die Wissen werden trocken gelegt. Vom Parteivorsitzenden von Vasma erfahre ich, dass das Dorf wieder neu entstehen soll. Sofort wird mir klar: Dort werde ich bei jedem folgendem Dreh Aufnahmen machen die Wiedergeburt des Dorfes dokumentieren.
Es folgen vier weitere Drehzeiten mit einem größeren Team, um auch aufwendigere Aufnahmen machen zu können wie zum Beispiel auf der Gedenkstätte Chatyn. (Dazu immer wieder das mühselige Suchen von Mosaiksteinchen in den Archiven.)
Riesengroß ist das Gebiet, das ich durchforste: 1000 Kilometer lang ist die „Rollbahn" Brest-Moskau, wie die Autobahn Nr. 1 von der polnischen Grenze bis zur Hauptstadt im deutschen Landserjargon genannt wurde. Und rechts und links davon jeweils 200, 300 Kilometer häufig schwer zugängliches, unwegsames Terrain: im Süden bis zur Ukraine und im Norden bis Litauen. Das war das Aktionsfeld der Heeresgruppe Mitte, auf deren Spuren ich forsche.
Zu allen Jahreszeiten drehe ich. Das weißrussische Volk ist in seiner Grundstruktur ein Bauernvolk, das ganz selbstverständlich in den Kreislauf der Natur eingebettet ist. So halte ich es auch für meinen Film für wichtig, die Dimensionen der verschiedenen Jahreszeiten einzufangen. Ein weiterer Grund: An Orten mit für mich wichtigen Geschehnissen will ich auch zu dem Zeitpunkt, mindestens jedoch zur gleichen Jahreszeit drehen, zu der sie sich ereigneten. Die vielen Aufenthalte kommen mir natürlich für die Langzeitbeobachtung des Aufbaus des Dorfes zugute.
Während meiner letzten Drehzeit in der Sowjetunion, im Oktober 1990, will ich als Abschluss dieser Aufnahmen im Baukombinat Vasma drehen, wo die Betonfertigteile vorfabriziert werden, aus denen auch „unser" Dorf zusammengesetzt wurde. Immer wieder werde ich auf den nächsten Tag vertröstet, trotz der Drehgenehmigung, die ich schon lange vorher beim Parteisekretär eingeholt hatte. Immer wieder betretenes Schweigen auf sowjetischer Seite, wenn ich an die Aufnahmen erinnere, die ich unbedingt brauche. Endlich, am letzten Tag unseres Aufenthaltes in Vasma, können wir ins Werk.
Später erfahren wir den Grund der Verzögerung: Als der Parteisekretär die Drehgenehmigung erteilte, konnte er noch nicht ahnen, dass alle Arbeiter zu dieser Zeit zum Ernteeinsatz auf die Felder mussten, um die Kartoffeln aus der nassen Erde zu holen. Das Baukombinat wurde geschlossen. Aber er steht bei mir im Wort. Also beordert er Männer und Frauen einer Brigade in die Fabrik zurück, um die Maschinen in Betrieb zu setzen, während der paar Tage einige Wände zu gießen und Fensterrahmen zu schreinern - doch das Trocknen des Betons dauert. Als wir in die Halle kommen, arbeiten alle, als wenn nichts geschehen wäre. Und wir filmen ahnungslos ein potemkinsches Dorf.
Diese Geschichte wirft aber auch ein Licht auf die Schwierigkeiten, denen NOWOSTI während der langen Drehzeit zunehmend mehr und mehr ausgesetzt ist: die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die eine präzise Planung und Organisation fast unmöglich machen, da es an allem fehlt und sich überall Apathie oder Unwille breitmacht. Es zeigt aber auch den guten Willen unserer sowjetischen Mitarbeiter, es trotz dieser Widrigkeiten zu schaffen - für das Projekt und zum Gedenken an die Opfer des Überfalls vor fast 50 Jahren.
Dabei müssen vermehrt auch ideologische Barrieren aus alter Stalinzeit abgebaut werden, die immer noch tief verwurzelt sind, wie wir erleben, als ich darum bitte, mit Zwangsarbeitern*innen Interviews drehen zu dürfen.
Unser örtlicher Begleiter vom Parteikomitee schüttelt den Kopf. Er kenne keine. Doch ich lasse nicht locker, kann einfach nicht glauben, dass im Kreis Vasma keine zu finden sind, wusste ich doch aus Dokumenten, dass die Deutschen mehrere zehntausend Menschen aus dieser Gegend ins Reich verschleppten. Schließlich sind doch zwei Frauen bereit, uns darüber zu berichten. Als wir Marija Kolesnikowa in Tumanowo gegenübersitzen, erfahren wir den Grund für ihr Schweigen.
Zwangsarbeit geleistet zu haben, ist immer noch für viele Menschen in der Sowjetunion ein Stigma. Man schämt sich, verschleppt worden zu sein, verheimlicht dieses Unrecht, dessen Opfer man war. Denn wenn die Nachbarn davon erfahren, liegt leicht das Wort „Kollaborateur" auf den Lippen, oder sie beschimpfen einen gar als Faschisten.
Über die wirklichen faschistischen Kollaborateure - die es auch in großer Zahl in Belo-russland gab - wurde in der Sowjetunion der Mantel des Schweigens ausgebreitet. Es war bis vor kurzem ein Tabu-Thema. Um so bemerkenswerter, dass mir auf meiner letzten Reise Archiv-Filmaufnahmen zur Verfügung gestellt wurden, die erst wenige Tage zuvor der KGB für wissenschaftliche Forschungsarbeiten freigegeben hatte.
Erst Glasnost und Perestroika schufen ein neues Klima, in dem es möglich ist, Dinge offen auszusprechen, für deren Erwähnung man noch vor wenigen Jahren harte Strafen zu erwarten hatte. So wundere ich mich nicht, dass die erfahrenen Alten immer noch vorsichtig sind. Noch trauen sie der Stabilität der neugewonnenen Freiheiten nicht so recht. Zu oft haben sie miterlebt, wie neugeschöpfte Hoffnungen zerrannen und die, die unbekümmert und mutig darauf setzten, dafür büßen und häufig gar mit ihrem Leben bezahlen mussten.
So vertraut mir Jossif Wainorowitsch, der Frontkameramann im 2. Weltkrieg, erst während meines dritten Aufenthalts in Minsk vor der Kamera das Schicksal der Bilder des Leidens an, die er beim Vormarsch der Deutschen und bei der Befreiung gedreht hatte; dies, obwohl ich schon vorher lange lnterviews mit ihm gedreht hatte und wir schon gut befreundet waren. Ähnlich wie bei der Berichterstattung über den Golfkrieg waren die Bilder von einstürzenden Häusern, flüchtenden Zivilisten, verstümmelten und toten Menschen, von Lagern und KZs, von Hungernden und Sterbenden unter Stalin unerwünscht. Sie wurden nicht ,,übersehen", sondern auf Anordnung in den Archiven verbrannt.
Nicht so erfahren-vorsichtig verhält sich die junge Generation. Glasnost und Perestroika schufen ihr neues Selbstbewusstsein. Offen erzählt Mischa bei den Ausgrabungen auf dem ehemaligen Schlachtfeld am Dnjepr von den Sperrtruppen des NKWD (Truppen des Innenministeriums), die jeden Rotarmisten abschossen, der zurückweichen wollte. Er und seine Kollegen lassen sich auch nicht mehr vorschreiben, wessen Freund und Feind sie zu sein haben. Sie ehren die Toten - die sowjetischen und die deutschen - gleichermaßen, wenn sie deren Überreste ausgraben. Für sie gilt, was Mischa im Film sagt: ,,Die Russen sind Menschen und die Deutschen sind Menschen“.